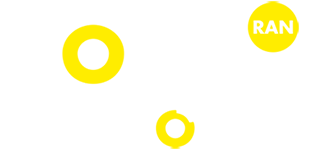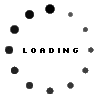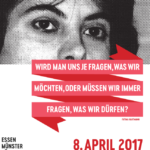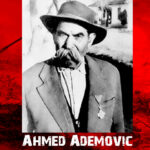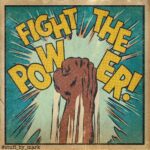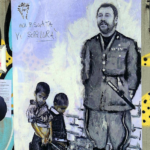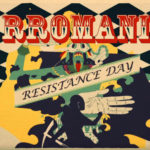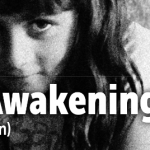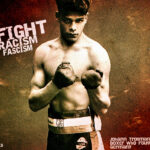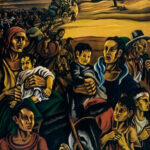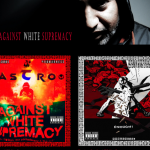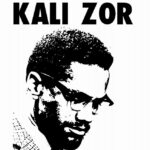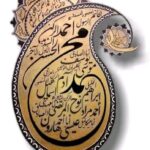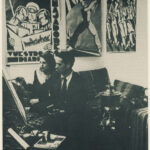Die Leitungen von drei Göttinger Grundschulen haben sich im Mai mit einem „Brandbrief“ an die Stadt Göttingen gewandt. Das Göttinger Tageblatt hat darüber berichtet und in einem weiteren Artikel auch unsere damalige Stellungnahme aufgegriffen. Nun ist ein weiterer Artikel im GT erschienen, in dem die Schulen ihre Überforderung mit „rumänischen Kindern“ und die Untätigkeit der Stadt beklagen.
Die Schulleitungen schrieben im Mai, die „erfolgreiche Beschulung der rumänischen Kinder“ sei an ihren Grundschulen gescheitert und beziehen sich direkt auf die „rumänischen“ Kinder, die in der Groner Landstraße 9 leben. Dort leben sowohl Angehörige der rumänischen Mehrheitsbevölkerung als auch rumänische Roma. Letztere erleb(t)en in Rumänien eine anhaltende Marginalisierung und gravierende Formen struktureller, institutioneller und alltäglicher Diskriminierung. Diese Erfahrungen bringen sie mit nach Göttingen. Im Artikel vom August 2024 werden nun zusätzlich etwa 200 „rumänische“ Kinder im Iduna-Zentrum verortet. Ob sie dort gemeldet sind oder nur zu Besuch, weiß die Stadtverwaltung aus nicht genannten Gründen nicht. Aber sie besuchen, zumindest suggeriert das der Artikel, besagte Grundschulen. Es handelt sich um Grundschulen, die fast ausschließlich von Kindern bürgerlich-akademischer Herkunft besucht werden.
Nun sind sie mit Kindern konfrontiert, die aus einem gänzlich entgegengesetzten Milieu stammen: diskriminiert, deklassiert, exkludiert. Der August-Artikel im GT spricht von „Integration durch Bildung“. Wir sprechen von Desintegration durch Rassismus. In Rumänien waren Roma die ersten, die nach dem Kalten Krieg ihre Arbeit verloren haben. Es folgte die gesellschaftliche Abwärtsspirale, während die fast 500 Jahre währende Versklavung der rumänischen Roma, die erst Mitte des 19. Jahrhunderts abgeschafft wurde, nie aufgearbeitet und kaum im Bewusstsein der rumänischen Mehrheitsbevölkerung ist. Während der realsozialistischen Ära wurde Rassismus, zumindest offiziell, durch die formale Gleichheit unterdrückt. Nach dem Zusammenbruch der sozialistischen Systeme brachen sich regressive Ideologien der Ungleichheit, des Rassismus und des Nationalismus Bahn und führten zu einer weitgehenden Schlechterstellung von Roma in den Gesellschaften.
Heute ist die Situation von vielen Roma in Rumänien derart desolat, dass sie keinen anderen Ausweg sehen als zu migrieren. Diskriminierung ist auf allen Ebenen der Gesellschaft vorhanden. Selbst Roma mit Hochschulabschlüssen haben kaum eine Chance, eine Arbeit zu bekommen, weil sie Roma sind. Wie Amnesty International schreibt, ist Polizeigewalt gegen Roma weit verbreitet. Das gleiche gilt für Hate-Speech durch Politiker:innen, Schul- und Wohnsegregation sowie systematische Diskriminierung. Gleichzeitig setzt der Staat auch das seit ein paar Jahren existierende Gesetz gegen die Verbreitung von Rassismus nicht wirksam durch und es komme nur selten zu Strafverfolgungen. Darüber hinaus hat die Corona-Pandemie die Situation der Roma in Rumänien in diversen Bereichen noch verschlechtert, befindet der Europarat.
In Deutschland erleben wir seit mehr als 30 Jahren eine Abwehr gegen Flucht und Migration rumänischer (und anderer) Roma. Der Pogrom von Rostock-Lichtenhagen, der sich gerade zum 32. Mal gejährt hat, war der gewalttätige Höhepunkt eskalierten rassistischer Ausschreitungen Anfang der 1990er Jahre in einem Klima medialer und politischer Hetze gegen (rumänische) Roma. Der Umgang mit den geflüchteten Roma in Rostock war von besonderem Rassismus geprägt: So mussten geflüchtete Roma vor der Zentralen Aufnahmestelle in Lichtenhagen ohne jede Versorgung und ohne sanitäre Anlagen kampieren, was seitens der Politik mit der „Roma-Kultur“ gerechtfertigt wurde. Die menschenunwürdigen hygienischen Zustände Lebensmitteldiebstähle wurden dann nicht der Politik angelastet, sondern den Roma selbst und schürten weiteren Rassismus, denn die unwürdigen Zustände wurden als „typisch Roma“ gewertet.
Im Kontext der Berichte über die Kinder aus der GL9 und neuerdings wieder aus dem Iduna-Zentrum spielen mit ähnlichen Vorstellungen. Diese Kinder wüssten nicht einmal wie man eine Toilette benutzt. Der Unterschied ist, dass heute nicht mehr von Z* die Rede ist, sondern von „rumänischsprachigen Kindern“ oder „Kindern aus Rumänien“. Denn wir sind weiter im Diskurs und man weiß heute in der bürgerlichen Gesellschaft, was sagbar ist und was nicht. Der Antiziganismus bleibt der gleiche.
Wenn in Bezug auf südosteuropäische Staatsangehörige die Rede ist, die als „integrationsunwillig“ beschrieben werden, sind meistens Roma (oder als Roma gelabelte Menschen) gemeint, auch wenn das nicht explizit so benannt wird. Diesen diskursiven Kniff haben z. B. Neuburger und Hinrichs in ihrer von der Unabhängigen Kommission Antiziganismus in Auftrag gegebenen Studie Mechanismen des institutionellen Antiziganismus bearbeitet. Sie bezeichnen den Diskurs zur Migration aus Rumänien und Bulgarien als einen schlecht kodierten antiziganistischen Problematisierungsdiskurs.
Auch in Göttingen wiederholen sich bestimmte Formen von Marginalisierung und Diskriminierung, wie wir etwa an der stigmatisierenden und kriminalisierenden Aktion von Stadt und Polizei Göttingen am 9. April in der Groner Landstraße 9, 9a und 9b gesehen haben.
Ein anhaltender und folgenschwerer Ausdruck institutioneller Diskriminierung ist die Bildungssegregation. Sie manifestiert sich in Rumänien auf andere Weise als in Deutschland, hat jedoch hier wie dort weitreichende Folgen. In Deutschland besteht sie in der überproportionalen Beschulung von Roma-Kindern in sogenannten Förderschulen (für geistige Entwicklung), ohne dass die Kinder eine Behinderung o.Ä. hätten. Sie haben zwar aufgrund ihres sozio-ökonomischen Hintergrunds häufig einen Förderbedarf, jedoch führen die Förderschulen nicht dazu, dass Roma-Kinder die gesellschaftlichen Nachteile, die sie aufgrund ihrer Zugehörigkeit zu einer marginalisierten Gruppe erfahren, aufholen könnten und sie anschließend an gleichberechtigter Bildung teilhaben könnten. Die Beschulung in Förderschulen führt im Gegenteil dazu, dass die Kinder keinen regulären Schulabschluss erlangen und damit kaum Perspektiven auf dem Arbeitsmarkt haben. Da sie selbst von Bildung weitgehend ausgeschlossen werden, setzt sich dieser Kreislauf auch bei ihren Kindern wiederum fort.
Die Benachteiligungen, die Roma-Kinder erleben, können so nicht abgebaut werden. Hier braucht es tatsächliche Förderung und Unterstützung. Vor allem in Serbien und anderen südosteuropäischen Ländern gibt es erfolgreiche Modelle, die auch an manchen Orten in Deutschland adaptiert und erfolgreich angewendet werden. Bekannt ist hier v.a. Hamburg, wo das Konzept seit über zehn Jahren sehr erfolgreich angewendet wird. Das ist das Konzept der Schulmediation oder Bildungsbegleitung. Es besteht wesentlich darin, dass
Roma-Organisationen Personen ausbilden, die notwendigerweise aus der Roma-Community stammen. Diese Personen haben eine Brückenfunktion zwischen Community und Mehrheitsgesellschaft, unterstützen sowohl die Kinder und ihre Eltern als auch die Schulen und ihr Personal. Die Mediator:innen müssen bei Roma-Selbstorganisationen angesiedelt sein. Andere Institutionen genießen nicht das nötige Vertrauen der Community.
Auch das Roma Center hatte einen Schulmediator, der im Landkreis Göttingen an einer Schule eingesetzt wurde. Trotz seiner erfolgreichen Arbeit mit den Kindern, die auch von den Lehrkräften als stark entlastend empfunden wurde, kam es zu keiner Weiterfinanzierung seiner Arbeit. Folglich musste er seine Arbeit einstellen.
Das Roma Center plädiert seit vielen Jahren für dieses Konzept, sowohl in Stadt als auch im Landkreis Göttingen. Denn auch die Kinder, deren Familien vor den Kriegen in Jugoslawien flüchteten und aus dem Kosovo vertrieben wurden, sind nach wie vor in prekären Situationen. Gerade angesichts dieser Erfahrungen, sollte man auch in Göttingen endlich neue Wege finden, um sowohl die Kinder zu fördern als auch die Schulen mit funktionierenden Konzepten zu entlasten.
Konkret bieten wir hierzu an, mindestens eine Schulmediatorin aus der Groner Landstraße 9 und einen Schulmediator aus dem Idunazentrum auszubilden, die als Vermittler:innen zwischen den Familien und der Institution Schule sowie weiteren Institutionen eingesetzt werden können. Hierfür braucht es die Finanzierung der Mediator:innen durch die Stadt Göttingen. Seit Jahren werden in der Stadt Göttingen (wie auch an anderen Orten) immer wieder Projekte „für“ Roma umgesetzt, die notwendigerweise scheitern, weil sie an den Bedarfen der Community vorbeigehen und durch Träger erfolgen, zu denen die Community kein Vertrauen hat. Das Scheitern wird jedoch nicht auf diese Punkte zurückgeführt, sondern Roma werden als „nicht integrationsfähig“ erklärt. Dies trägt letztlich zur fortwährenden Stigmatisierung bei.
Der „Brandbrief“ der Schulleitungen enthält in Teilen Stigmatisierungen – eine Ausdrucksweise wie „dissoziales Verhalten“ sollte sich, gerade angesichts der deutschen Geschichte und v.a. in Bezug auf kleine Kinder, von selbst verbieten.
Die Schulleitungen beklagen das Fehlen von Dolmetscher:innen. Ja, das ist ein Problem. Jedoch ist hier große Vorsicht geboten. Häufig werden Dolmetscher:innen aus der (in diesem Fall rumänischen) Mehrheitsbevölkerung eingesetzt, die für Angehörige der Roma-Community übersetzen. Dies ist hochproblematisch. Es reicht nicht, wenn Menschen die gleiche Sprache sprechen. Auch Machtverhältnisse sind zu berücksichtigen. Immer wieder erleben wir in unserer täglichen Arbeit die teils drastischen Folgen von Übersetzungen, die gefärbt sind von den Vorurteilen der Übersetzer:innen, die sie aus ihren Herkunftsländern mitbringen. Der von den Schulleitungen vorgeschlagene Dolmetscherdienst kann nur funktionieren, wenn er aus der Community heraus besetzt wird. Ansonsten sind weitere Probleme vorprogrammiert. Zusammengefasst heißt das: Nur Menschen aus der Roma-Community sollten für Roma übersetzen.
In Teilen stimmen wir dem Brief allerdings auch zu. Kita- und Kindergartenplätze fehlen tatsächlich. Das sehen wir auch als großes Problem. Erschwerend kommt institutionelle Diskriminierung hinzu, sodass Roma-Familien häufig keinen Kita- oder Kindergartenplatz und andere Familien bevorzugt werden. Der marginalisierende Effekt greift so bereits in der frühen Kindheit.
Wir bieten auch weiterhin der Stadt unsere Unterstützung an. Wie erwähnt, sehen wir es als notwendig an, dass die Stadt Schulmediator:innen finanziert, die vom Roma Center ausgebildet werden und in Kooperation mit uns eingesetzt werden.
Gleichzeitig bieten wir auch gerne Gespräche, Fortbildungen und Schulungen für Mitarbeiter:innen von Behörden, Schulen und anderen Institutionen sowie Trägern an, damit sie verstehen, aus welcher Situation die Kinder kommen und wie man sie besser unterstützen kann.
Roma Center e.V./ Roma Antidiscrimination Network