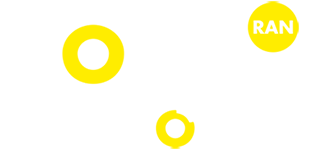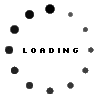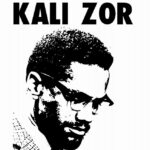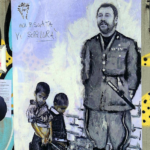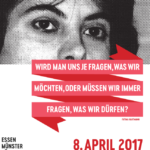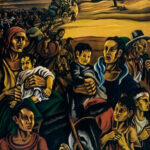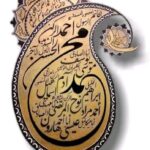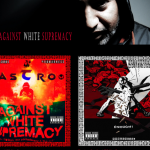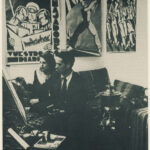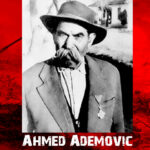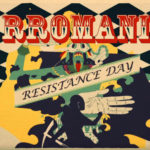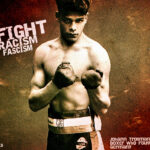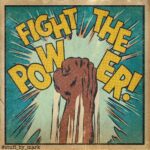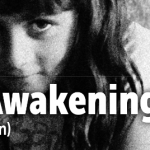Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) hat sich in einem Urteil vom 30. März 2023 erneut mit der Frage von Bildungsdiskriminierung von Roma in Form von Schulsegregation befasst, dieses Mal in einem Fall aus Ungarn.
Fast neun Jahre mussten der 2005 geborene Rom Imre Szolcsán aus Piliscsaba, einer Kleinstadt nordwestlich von Budapest, und seine Mutter darum kämpfen, dass die vom ihm erlittene Diskriminierung anerkannt wurde. Institutionen und Gerichte in Ungarn lehnten jahrelang seine Klagen und Anträge ab und rechtfertigten den Status Quo. Für den mittlerweile 17-Jährigen gab es nun eine späte Genugtuung. Der Fall macht aber deutlich, wie enorm hoch die Hürden sind, die ungarische Roma an der Wahrnehmung ihrer Rechte hindern und wie stark Institutionen und Gerichte das System der Diskriminierung stärken.
Imre Szolcsán besuchte im Schuljahr 2013/14 die Grundschule Jókai Mór in seiner Heimatstadt. Obwohl nur vier Prozent der Bevölkerung der Stadt Roma sind, wurde diese Schule ausschließlich von Kindern aus der Roma-Community besucht. Nur zehn Prozent der Schüler*innen der Grundschule Jókai Mór gehen danach auf weiterführende Schulen. Die personelle und materielle Ausstattung der Schule sowie das Lernniveau gelten als schlecht. Deswegen beantragte die Mutter der damals achtjährigen Imre Szolcsán zum Schuljahr 2014 den Wechsel auf eine andere Schule in der Nachbarstadt, die nur fünf Minuten Busfahrt entfernt liegt. Dieses Gesuch wurde vom Schulleiter ohne Begründung abgelehnt.
Gegen diese Entscheidung wurde eine Beschwerde bei der örtlichen Schulbehörde eingelegt. Diese wurde mit der Begründung abgelehnt, die Schule Jókai Mór sei die nächstgelegene Schule zum Wohnort, und falls er diese nicht besuchen wolle, könne er eine der anderen beiden Schulen in Pilicsaba besuchen. Bei diesen Schulen handelt es sich allerdings um eine katholische Schule und eine Schule der deutschen Minderheit, in der wesentliche Teile des Unterrichts in deutscher Sprache stattfinden und Lerninhalte auf Angehörige der deutschen Minderheit ausgerichtet sind.
Imre Szolcsáns Mutter wollte jedoch, dass ihr Sohn eine säkulare ungarische Schule besucht.
Die Familie klagte vor verschiedenen ungarischen Gerichten, und jedes Mal wurde die Klage abgewiesen – mit wenig überzeugenden Argumenten, wie der EGMR befand. Teilweise wurde bestritten, dass der Bildungsstandard in der Grundschule Jókai Mór niedriger sei, teilweise wurde darauf gepocht, dass er eine Schule an seinem Wohnort besuchen müsse – obwohl bereits 27 andere Schüler*innen aus Pilicsaba die Schule besuchten, auf die Imre Szolcsán wechseln wollte. Im Sommer 2016 lehnte schließlich das ungarische Verfassungsgericht eine Befassung mit dem Fall ab, mit der Begründung, es würden keine verfassungsrechtlichen Fragen durch den Fall aufgeworfen. So blieb nur der Gang zum EGMR.
In einer Stellungnahme im Rahmen des Verfahrens brachte die Rosa-Parks-Stiftung einige Hintergrundinformationen ein, die das volle Ausmaß der Diskriminierung und Segregation von Roma im ungarischen Bildungssystem verdeutlichen. So gab es zum Zeitpunkt der Klage 381 Schulen in Ungarn, in denen mehr als 50% der Schüler*innen Roma waren, und 45% der Kinder aus der Roma-Community besuchten Schulen, die ausschließlich von Roma besucht wurden.
Die Regierung habe keine Maßnahmen zur Reduzierung der Segregation ergriffen, und seit 2010 habe sich die Situation verschlechtert. Die Bildungschancen für Roma und der Abstand zwischen Roma und nicht-Roma im Bildungsbereich seien größer geworden. Gerichtsurteile, die Maßnahmen gegen Segregation anordneten, seien nicht umgesetzt worden und auch ein 2016 eingeleitetes Vertragsverletzungsverfahren der EU habe keine Auswirkungen gehabt. Betroffene Familien hätten kaum Möglichkeiten, ihre Kinder aus segregierten Schulen herauszuholen, da es keinen Anspruch auf einen Wechsel auf eine andere Schule gebe, und weil entsprechende Gesuche oft an bürokratischen oder informellen Hürden scheitern würden – zum Beispiel, wenn Gesuche ohne Begründung oder nur mündlich abgelehnt werden oder wenn Betroffenen fälschlicherweise gesagt wird, dass sie kein Recht haben, die Schule zu wechseln.
Der EGMR stellte eine Verletzung von Artikel 14 der Europäischen Menschenrechtskonvention (Diskriminierungsverbot) fest und wies in seinem Urteil darauf hin, dass es sich nicht erst dann um Diskriminierung handelt, wenn eine diskriminierende Absicht vorliegt. Das heißt, die Verantwortlichen können sich nicht hinter der Ausrede verstecken, sie hätten nicht diskriminieren wollen, und Betroffene müssen nicht beweisen, dass hinter einer diskriminierenden Maßnahme eine Absicht zur Diskriminierung steckte.
Imre Szolcsán wurde ein Schadenersatz in Höhe von 7000 Euro sowie Kostenerstattung in Höhe von etwas über 4500 Euro zugesprochen – eine späte Genugtuung nach fast neunjährigem Kampf für den damaligen Grundschüler, der mittlerweile 17 Jahre ist und eine Ausbildung zum Schweißer absolviert. „Obwohl dieses Urteil die Vergangenheit nicht ändern kann, brachte es doch eine gewisse Genugtuung nach der demütigenden Behandlung“, sagte Imre Szolcsáns Mutter laut einer Pressemitteilung des European Roma Rights Centre.
Siehe auch: