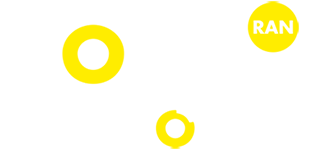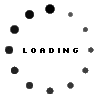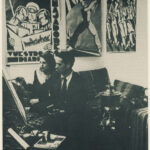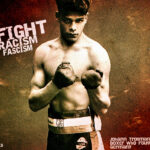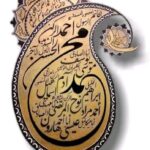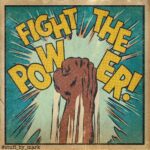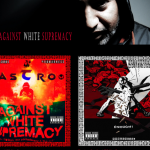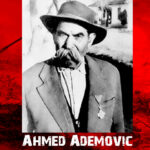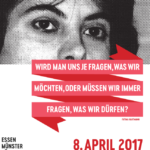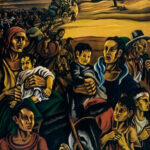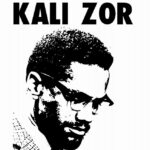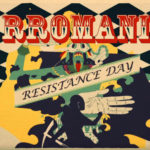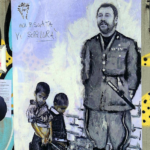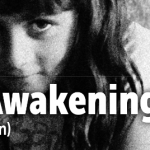EU fördert mit einer Milliarde Euro Menschenrechtsverletzungen gegen Roma
Für Roma-Organisationen ist es ein lange bekanntes Ärgernis: In den letzten Jahrzehnten wurden Millionen in Projekte „für“ Roma gepumpt, während sich die Lage der Community kaum verbessert hat. Im Gegenteil. Die „Integration“ von Roma ist für viele Kommunen, Institutionen und Träger der Mehrheitsgesellschaft ein lukratives Geschäftsmodell. Wenn die Projekte nicht funktionieren, wird dies immer wieder auf die vermeintlich mangelnde Integrationsfähigkeit von Roma zurückgeführt – um so ein weiteres Projekt beantragen und Mittel generieren zu können.
Roma-Selbstorganisationen kritisieren dies seit langem, weil diese fehlgeleiteten Projekte nicht zuletzt zu Rassismus gegen Roma beitragen. Denn auch die Mehrheitsbevölkerung, insbesondere in den Staaten mit signifikanter Roma-Community, nimmt wahr, dass viel Geld in die „Integration“ von Roma investiert wird, aber sich deren Lage nicht verbessert. Statt die Projekte und deren Träger in Frage zu stellen, wird auch hier die Verantwortung bei der Roma-Community gesucht. Übersehen wird dabei, dass von den vielen Mitteln wenig bis nichts bei den Menschen ankommt.
Nun hat Bridge EU, eine belgische Menschenrechtsorganisation, im Rahmen ihres EU geförderten Projekts FURI einen Bericht vorgelegt, in dem sie nachweist, wie EU geförderte Projekte in sechs Mitgliedsstaaten gegen Menschenrechte verstoßen.
Untersucht wurden insgesamt 63 Projekte mit einem Gesamtvolumen von 1,1 Milliarden Euro in Ungarn, Polen, Tschechien, Griechenland, Rumänien und Bulgarien. Die Untersuchung konzentrierte sich auf praktische Erkenntnisse zu Rechtsverletzungen mit Fokus auf Roma-Communities, Menschen mit Migrationshintergrund und Menschen mit Behinderungen. Vergeben wurden die Mittel über Programme wie den Europäischen Sozialfonds (ESF), den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung oder den Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds (AMIF). Der Bericht stellt fest:
„Obwohl die EU-Fördervorschriften Bestimmungen zur Einhaltung der Grundrechte enthalten, zeigt die Untersuchung weitverbreitete Nichteinhaltung in allen teilnehmenden Ländern.“
Bildungs- und Wohnsegregation von Roma-Communities und Kindern mit Behinderungen gehören zu den monierten Verstößen. Bildungssegregation, die auch in Deutschland ein weitreichendes Problem darstellt, führt zu einer minderwertigen Bildung für die betroffenen Kinder und behindert ihre gesellschaftliche Partizipation. Segregation im Bildungsbereich gehört zu den folgenreichsten Diskriminierungsformen. Die Europäische Kommission hat bereits Maßnahmen gegen einige Mitgliedsstaaten eingeleitet, darunter Tschechien und Ungarn. Im Falle der Slowakei (die in diesem Bericht nicht untersucht wurde) sind die Maßnahmen inzwischen soweit, dass der Staat beim Europäischen Gerichtshof wegen Verstoßes gegen die Richtlinie zur Gleichbehandlung ohne Unterschied der Rasse verklagt wurde.
FURI monierte Projekte in Rumänien und Bulgarien, die die Bildungssegregation gegen Roma-Kinder verstärkten. Zum Teil wurde direkt in Segregation investiert, andere Projekte hatten zwar positive Absichten, jedoch haben die Projekte zu mehr Segregation geführt und damit die Rechte der betroffenen Schüler:innen verletzt. So zielte das Projekt ‘Ready for Success’ (Bulgarien) zwar darauf ab, die Inklusion von Roma-Communities in das Bildungssystem zu fördern, soziale Isolation zu bekämpfen, einem frühzeitigen Schulabbruch vorzubeugen und einer späteren Ausgrenzung vom Arbeitsmarkt entgegenzuwirken. Der Schwerpunkt des Projekts lag jedoch „hauptsächlich auf Verhaltenskorrektur und Einstellungsänderung in Roma-Communities – was verdeutlicht, dass die zugrunde liegende Annahme fehlerhaft ist. Dieser Ansatz verfehlt es, breitere Probleme wie Armut und räumliche Segregation anzugehen, und ignoriert zudem die tieferliegenden systemischen Ursachen für Bildungsungleichheiten.“ Zudem zeige sich die Tendenz, die Community verantwortlich zu machen, und offenbare diskriminierende Haltungen, anstatt die zugrunde liegenden strukturellen Probleme zu analysieren.
Auch bei einem anderen Projekt in Bulgarien kommt FURI zu einem ähnlichen Ergebnis: Die Zugrunde liegenden systemischen Probleme werden nicht angegangen, und das Projekt setze vornehmlich auf die Verhaltensänderung bei den Angehörigen der Community, was impliziere, dass das Problem in dieser liege. Aus unserer Erfahrung ist diese Sichtweise leider ein grundlegendes Problem bei vielen Trägern und ihren Mitarbeiter:innen. Diese sind nicht in der Lage (oder Willens), die strukturellen und institutionellen Mechanismen zu reflektieren, die zu Marginalisierung und bestimmten Verhaltensweisen führen und können daher deren Ursachen nicht beheben.
Für ein EU gefördertes Infrastrukturprojekt in Rumänien mit einem Volumen von 5,5 Millionen Euro wurde eine informelle Roma-Siedlung abgerissen, um dort einen öffentlichen Park anzulegen. Die Bewohner:innen wurden zwangsgeräumt und ihre selbstgebauten Unterkünfte abgerissen. Sie konnten nicht einmal ihren persönlichen Besitz retten.
Diese Art von Räumungen ganzer Siedlungen kommt immer wieder vor, sowohl in den Ländern der Europäischen Union als auch in den Balkan-Ländern. Begründet werden die Abriss-Aktionen unter anderem damit, die Siedlungen seien informell (also ohne Baugenehmigung) errichtet worden, es fehle an sanitären Anlagen oder sie seien eine Gefahr für die Bewohner:innen (z.B. wegen der mangelnden hygienischen Verhältnisse oder weil sie selbst Strom verlegt haben). Gelegentlich werden die Siedlungen auch als Kollektivbestrafung für tatsächliches oder angebliches Fehlverhalten vereinzelter Mitglieder der Community abgerissen: Eine Person begeht mutmaßlich eine Straftat, und statt das Gerichtsverfahren gegen diese Person abzuwarten, wird die gesamte Nachbarschaft bestraft. Die Räumungen selbst sind häufig rechtswidrig. Regelmäßig interveniert der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte, jedoch meist vergebens. Die Bewohner:innen bleiben in aller Regel obdachlos zurück.
Eines der von FURI untersuchten Projekte in Ungarn hatte zum Ziel, die Lebensbedingungen in einer Roma-Siedlung zu verbessern. Die Zwangsräumung von 80 Personen, darunter mehr als 50 Kinder, wurde geplant. Diese Räumungen wurden als Verstoß gegen EU-Recht und ungarisches Recht eingestuft. Beschwerde wurde bei der Europäischen Kommission eingelegt, welche die betreffende Kommune instruierte, den Familien provisorische Unterkunft zurr Verfügung zu stellen und sie nach der Renovierung in ihre alten Wohnungen zurückzulassen.
Die tschechische Stadt Kladno hat laut FURI Mittel aus dem Europäischen Sozialfonds für Projekte zur Integration von Roma-Communities erhalten. Gleichzeitig wurden mit diesen Mitteln rechtswidrige Praktiken gefördert, die diskriminierend gegenüber Roma und anderen sozial benachteiligten Gruppen waren. Auf diese Weise unterstützten EU-finanzierte Maßnahmen indirekt diskriminierende Vorgehensweisen, so der Bericht.
In der tschechischen Stadt Usti nad Labem „wurden Roma-Familien aus zentralen städtischen Gebieten in segregierte Stadtteile umgesiedelt, die nur eingeschränkten Zugang zu grundlegenden Dienstleistungen wie Bildung und Beschäftigung boten. Es wurden keinerlei Maßnahmen zur Entsegregierungs umgesetzt; stattdessen wurden die neu geräumten Innenstadtbereiche für kommerzielle Zwecke oder hochwertigen Wohnraum neu entwickelt.“ Dieses Vorgehen stellt laut FURI einen Verstoß gegen das Recht auf angemessenen Wohnraum dar, ist diskriminierend und behindert die Integration der Roma-Communities.
Auch im rumänischen Sfantu Gheorghe wurde mit 3 Millionen aus dem EU-Fonds ein Projekt umgesetzt, durch das segregierter Wohnraum und ein Kindergarten für 85 Roma-Kinder geschaffen wurden. Die Kinder hätten auch in den „normalen“ Kindergarten in der Nähe gehen können, wenn die Mittel zu dessen Ausbau genutzt worden wären.
Ungarn bekam knapp 175 Millionen Euro aus dem Europäischen Sozialfonds, um die Lebensbedingungen in 300 Roma-Siedlungen zu verbessern. Zu dem Projekt gehörten Bau- und Renovierungsmaßnahmen in segregierten Gebieten. Diese förderten keine Entsegregation, sondern verstärken vielmehr die Segregation von Roma-Communities, so der Bericht. Das Programm stehe seit Beginn unter starker Kritik von Roma- und pro-Roma-NGOs, da es keine öffentlich zugängliche Bewertung oder Wirkungsanalyse des Programms gebe und die Durchführung größtenteils von kirchlichen Wohltätigkeitsorganisationen übernommen werde, die in einem intransparenten Verfahren ausgewählt wurden.
***
Bei allen von FURI untersuchten marginalisierten Gruppen ist sexualisierte und geschlechtsspezifische Gewalt ein zentrales Element von Grundrechtsverletzungen. Diese Form der Gewalt ist in der gesamten EU grundsätzlich weit verbreitet. Institutionalisierung, segregierte Dienstleistungen und geografische Isolation sind dabei wichtige Vorbedingungen und begünstigende Faktoren. Hinzu kommen bei marginalisierten Gruppen Schwierigkeiten bei der Anzeige von Straftaten, beim Zugang zur Justiz, beim Erhalt von Schutz- und Unterstützungsleistungen sowie beim Überwinden rechtlicher und institutioneller Diskriminierung.
Bei der Untersuchung wurden mit vielen involvierten Akteur:innen Interviews geführt. Der Bericht konstatiert, dass „ein sehr geringes Verständnis der Grundrechtsverpflichtungen im Zusammenhang mit EU-Mitteln“ bestehe und sieht einen dringenden Bedarf, sowohl auf EU-Ebene als auch in den Ländern entsprechend nachzubessern, um Grundrechtsverletzungen zu verhindern und zu bekämpfen. Selbst bei gemeldeten Verstößen fehlt laut Bericht eine angemessene Reaktion durch nationale und EU-Behörden.
Der Bericht kommt zu dem Schluss, dass in den teilnehmenden Ländern ein geringes Verständnis für Grundrechtsanforderungen bei der Umsetzung von EU-Fördermitteln besteht, welches begleitet wird von unzureichenden personellen und finanziellen Kapazitäten. Aufgrund schwerer Fehlinterpretationen durch nationale und EU-Behörden werden Fördergelder weiterhin für gravierende Grundrechtsverletzungen eingesetzt. Ein Kompetenzstreit zwischen nationalen und EU-Behörden führt zu Untätigkeit und Straflosigkeit der Verantwortlichen. Zudem sind marginalisierte Gruppen und ihre Vertreter kaum in die Verwaltung und Kontrolle der Mittel eingebunden.
Insbesondere bei den Mitarbeitenden öffentlicher Verwaltungen zeigte sich ein sehr geringes Bewusstsein und Verständnis darüber, „wie Grundrechte in der Praxis anzuwenden sind. So erkannten viele Befragte beispielsweise nicht, dass segregierte Bildung von Roma-Kindern eine Form rassistischer Diskriminierung darstellt oder dass die Institutionalisierung von Menschen mit Behinderungen – unabhängig vom Umfeld – gemäß der UN-Behindertenrechtskonvention (CRPD) eine Form von Diskriminierung darstellt.“
Ein weiteres Problem stellt die mangelhafte Einbindung von Vertreter:innen marginalisierter Communities in Überwachungsausschüsse dar, wobei insbesondere Basisorganisationen mit begrenzten Kapazitäten und wenig Erfahrung in EU-geförderten Projekten von den Überwachungsausschüssen ausgeschlossen sind. Das führe dazu, dass die Programme und Projekte nicht gut auf die tatsächlichen Bedürfnisse dieser Gruppen reagieren oder diese berücksichtigen.
Zu der FURI-Untersuchung gehörte es auch, den Umgang mit Beschwerden hinsichtlich Grundrechtsverletzungen im Kontext von EU-Fördermitteln zu analysieren, der als besonders alarmierend zu bewerten ist. Es gehen allgemein relativ wenig formale Beschwerden ein, was seitens der zivilgesellschaftlichen Strukturen von Roma mit mangelnden Ressourcen und Kapazitäten erklärt werden kann. Kritisiert wird im Bericht, dass einige öffentlich bekannte Fälle trotz ihrer Relevanz nicht offengelegt wurden, da sie nicht als formale Beschwerden eingegangen sind.
Besorgniserregend ist auch, dass die Europäische Kommission bei der Bewertung von Diskriminierung auf Stellungnahmen nationaler Behörden zurückgreift – also auf jene, die selbst für die beanstandeten Maßnahmen verantwortlich sind. Diese bestätigten in keinem Fall eine Verletzung, was auf einen strukturellen Interessenkonflikt hinweist. Gleichzeitig interpretiert die Kommission Diskriminierung sehr eng – selbst Praktiken, die international als diskriminierend gelten (z. B. segregierte Bildung), wurden oft nicht als solche anerkannt. In nahezu allen untersuchten Fällen wurde trotz glaubwürdiger Hinweise auf Grundrechtsverletzungen keine weiteren Maßnahmen eingeleitet.
Die Roma-Selbstorganisation CHACHIPE (Dänemark) forderte in einer Stellungnahme an die Europäische Kommission vom 28. Mai 2025:
- Eine dringende unabhängige Überprüfung aller von der EU finanzierten Projekte mit Roma-Bezug in den betreffenden Ländern.
- Die Einrichtung eines Überwachungsmechanismus in Zusammenarbeit mit Roma-Organisationen auf europäischer und nationaler Ebene.
- Die Einbeziehung von Roma als gleichberechtigte politische Akteur:innen in allen Phasen der Planung, Entscheidungsfindung und Kontrolle von EU-Fonds.
- Eine öffentliche Entschuldigung der Europäischen Kommission bei den von diesen Projekten betroffenen Roma-Communities.
- Die Einleitung disziplinarischer und rechtlicher Schritte gegen diejenigen, die gemeldete Grundrechtsverletzungen ignoriert haben.
Dem schließt sich das Roma Center/ Roma Antidiscrimination Network an.
***
Der Bericht:
Bridge EU: 1.1 Billion Euros, 63 Projects, six Countries, one Pattern. How EU funds violate fundamental rights, May 2025, online unter: https://www.bridge-eu.org/_files/ugd/aba538_329823863b304d2d80eda3c6cdbf6aa3.pdf?index=true.
Sowie Anhang 4 mit den untersuchten Projekten:
Annex 4 – Project examples (Bulgaria, Czechia, Greece, Hungary, Poland, Romania): https://www.bridge-eu.org/_files/ugd/aba538_78b07593e19241e89266cff92a746153.pdf?index=true.
Das Foto zeigt den Bau von Containerunterkünften für Roma-Communities in Rumänien im Rahmen eines EU-finanzierten Projekts. ©Bridge EU